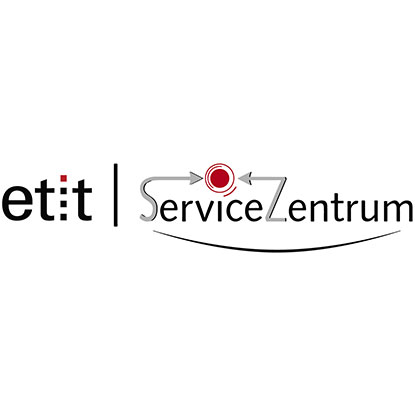„Bereicherung für die Medizin von morgen“
Studiendekaninnen des RMU-Kooperationsstudiengangs Medizintechnik im Interview – Teil zwei einer fünfteiligen Serie
01.10.2025
Gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt als Partnerin der Allianz der Rhein-Main-Universitäten (RMU) bietet die TU Darmstadt seit 2018 den Studiengang Medizintechnik an. Die beiden Studiendekaninnen Anja Klein und Miriam Rüsseler blicken zurück auf die Anfänge und wagen eine Prognose für die Zukunft.

Liebe Frau Klein, liebe Frau Rüsseler, zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Disziplinen über zwei Hochschulen hinweg zu einem Studiengang zu bündeln, das klingt nach einem mutigen Projekt. Was waren damals Ihre Visionen?
Professorin Dr.-Ing. Anja Klein, Studiendekanin im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (etit): Heute ist kein Lebensbereich mehr ohne Technik denkbar, ob im Alltag oder in Situationen, in denen Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Technik begleitet die Welt schon jetzt und noch stärker die Welt von morgen. Wir wollten einen Studiengang schaffen, in dem Grundlagen für Innovationen durch noch nicht selbstverständlich verknüpfte Disziplinen entstehen können – Innovationen, die die medizinische Versorgung von Menschen verbessern oder sogar Leben retten. Durch die Hartnäckigkeit und Einsatzbereitschaft meiner beiden Kollegen Professor Jürgen Adamy und Professor Ulrich Konigorski als Initiatoren und maßgebliche Akteure bei der Umsetzung konnte so ein Studiengang über zwei Universitäten hinweg geschaffen werden, der den Geist der Zeit trifft und deutlich macht: Gemeinsam sind wir stärker.
Professorin Dr. Miriam Rüsseler, Studiendekanin Klinik im Fachbereich Medizin: In unserem klinischen Alltag hat die Medizintechnik schon seit 100 Jahren einen festen und großen Stellenwert in verschiedensten Bereichen (z.B. Einsatz Herz-Lungen-Maschine seit 1953, Dialyse seit 1924, Sonographie seit 1942). Für eine Umsetzung von Fragestellungen aus dem klinischen Alltag in technische Lösungen bedarf es einer gemeinsamen Sprache zwischen Medizin und Technik und insbesondere auf beiden Seiten eines Verständnisses für den klinischen Alltag, um Produkte zu entwickeln, die wirklich anwendbar sind. Genau dies ermöglicht dieser Studiengang und bildet damit eine wesentliche Bereicherung für die Medizin von morgen.
Mein großer Dank geht hier an meinen Kollegen und Vorgänger im Amt als Studiendekan Professor Dr. Dr. Robert Sader, der die Vision dieses Studiengangs in die Umsetzung gebracht hat.
Wenn Sie Ihre Visionen vor fast zehn Jahren mit den heutigen Erfolgen vergleichen: Haben sich der Einsatz und der Mut von damals gelohnt?
Klein: Auf jeden Fall! Wir sehen Absolvent:innen, die beide Sprache sprechen – die der Medizin und die der Elektro- und Informationstechnik. Das ermöglicht erst eine effiziente und innovative Zusammenarbeit der Disziplinen. Das Interesse an dem Studiengang ist seit Anbeginn hoch, die Studierenden sind enorm intrinsisch motiviert, was sich nicht zuletzt in den überdurchschnittlich guten Abschlussnoten widerspiegelt. Alle Beteiligten, Studierende wie Lehrende, brennen für das Fach, weil es die Technik und den Menschen verbindet.
Rüsseler: Das großartige Engagement der Lehrenden und Dekanate bei der Konzeption und dem Aufbau des Studiengangs, insbesondere in der Ausdifferenzierung der einzelnen Module, hat sich gelohnt. Dies zeigt das große Interesse am Studiengang, sowohl im Bachelor als auch im Master. Insbesondere die bisherigen Bachelor- und Masterarbeiten zeigen, dass die Vision Früchte trägt.
Wir haben zudem sehr motivierte Studierende und Lehrende an beiden Universitäten, die mit großem Engagement die Weiterentwicklung des Studiengangs voranbringen.
Medizintechnik ist ein ingenieurwissenschaftlicher Studiengang, auch wenn er den Menschen in den Fokus stellt. Der Anteil an weiblichen Studierenden liegt bei etwa 50 Prozent – anders als in anderen ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Was ist das Geheimrezept?
Klein: Schon der Name des Studiengangs zeigt, dass hier die Technik mit und für Menschen gedacht wird. Auch in anderen Fächern mit einem hohen Anteil an weiblichen Studierenden ist dies für viele ein wichtiges Argument, wenn sie sich für das Fach entscheiden.
Natürlich haben auch die klassischen ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge genau das im Blick – aber bei der Medizintechnik wird es schon ab dem ersten Jahr greifbar, z.B. durch Einblicke in die Klinik und durch ein Berufsbild, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. So leistet der neue Studiengang auch einen wichtigen Beitrag zur Parität in der Wissenschaft. Mehr weibliche Studierende in ingenieurwissenschaftliche Studiengänge und Positionen zu bringen – geschafft!
Rüsseler: Der Studiengang kombiniert Medizin/Gesundheitswissenschaften mit Technik. Gerade diese Kombination macht ihn für weibliche Studierende attraktiv, sie kommen wegen der Medizin und können ihr Interesse für Informatik und Elektrotechnik damit verbinden. Leider wecken reine technische Studiengänge weiterhin selten das direkte Interesse weiblicher Studierender. Doch gerade die Diversität schafft andere Perspektiven und kreative Ideen für die Medizintechnik von morgen.
Für welche gesellschaftlichen Entwicklungen werden die Studierenden, die 2025 mit dem Studiengang Medizintechnik beginnen, Antworten finden können und müssen?
Klein: Die Gesellschaft wird älter, die Lebenserwartung steigt in westlichen Ländern. 2050 werden z.B. Schätzungen zufolge zwei Millionen Menschen in Deutschland mit Demenz leben. Aber auch der Bereich der personalisierten Medizin wird mehr an Bedeutung gewinnen. Hier stehen wir erst ganz am Anfang, durch die Technik wird es zukünftig für uns heute noch unvorstellbare Möglichkeiten geben, individuelle Diagnose- und Behandlungsverfahren zu optimieren.
Rüsseler: Die heutigen Herausforderungen in der Medizin sind vielfältig. Dies ist auf der einen Seite der bestehende Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite steht eine zunehmend älter werdende Gesellschaft mit multiplen chronischen Erkrankungen. Hier bedarf es kreativer Lösungen, wie Fachkräfte in der Versorgung unterstützt werden können.
Und nicht zuletzt die enormen wissenschaftlichen Fortschritte in der Diagnostik und Therapie, insbesondere bei verschiedenen Krebserkrankungen, brauchen Lösungen, um in der breiten, individuellen Anwendung umsetzbar zu sein.
Die Fragen stellte das Kommunikationsteam des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik (etit) an der TU Darmstadt.
Zahlen, bitte!
Der RMU-Kooperationsstudiengang Medizintechnik auf einen Blick
- 132 – Abschlüsse seit Start im Wintersemester 2018/19
- 256 – Zahl der Bachelor-Bewerbungen (Wintersemester 2024/25) für 120 Plätze
- 144 – Zahl der Master-Bewerbungen (Wintersemester 2024/25)
- 50,9 Prozent – Frauenanteil im Bachelorstudiengang (Wintersemester 2024/25)
- 58,8 Prozent – Frauenanteil im Masterstudiengang (Wintersemester 2024/25)
- 42 – Studierende mit Auslandsaufenthalt (Wintersemester 2024/25);beliebteste Ziele: Großbritannien, Irland, Skandinavien